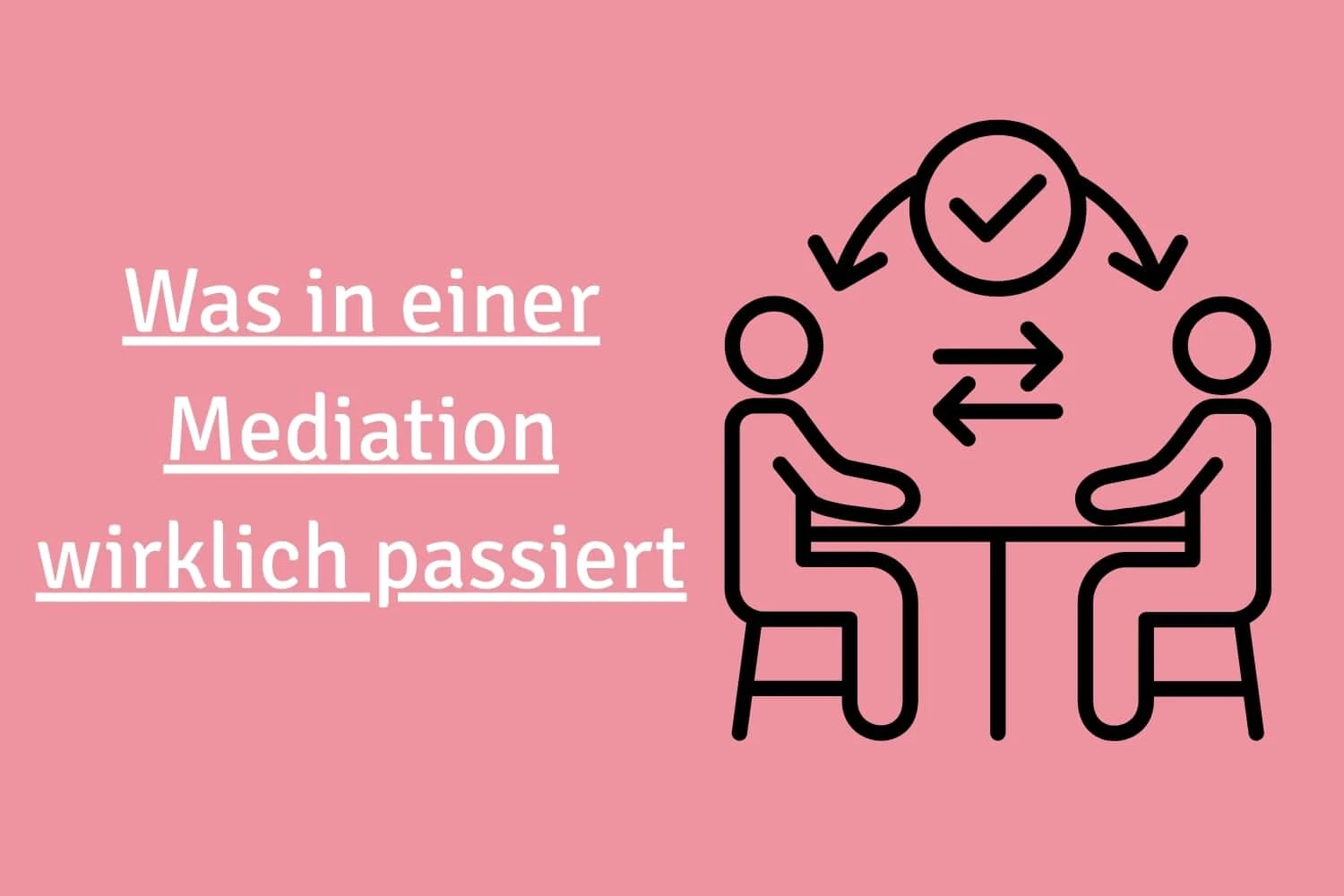„Hier wird gemacht, was ich sage!“ – vielleicht kennen Sie solche oder ähnliche Sätze aus angespannten Situationen im Beruf oder auch in der Familie.
Wo Menschen zusammenleben und arbeiten, gehören Konflikte zum Miteinander dazu.
Entscheidend ist dabei nicht, ob wir streiten, sondern wie wir es tun. Unser Verhalten in einem Konflikt entscheidet darüber, ob sich die Fronten verhärten oder ob wir eine gemeinsame, wertschätzende Lösung finden können.
Dieser Artikel soll Ihnen dabei helfen, den Unterschied zwischen destruktivem und konstruktivem Konfliktverhalten besser zu verstehen.
Sie lernen die fünf grundlegenden Konfliktstile und bewährte Modelle wie das Harvard-Konzept oder die Eskalationsstufen nach Glasl kennen.
Angereichert mit Praxis-Tipps aus meiner Erfahrung als Mediatorin, möchte ich Ihnen Mut machen und konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um Konflikte zukünftig ruhig und lösungsorientiert zu meistern.
Destruktives vs. Konstruktives Konfliktverhalten im Überblick
Im Kern eines jeden Konflikts steht eine Entscheidung:
Möchten wir Recht behalten oder möchten wir eine Klärung herbeiführen? Diese innere Haltung prägt unser gesamtes Verhalten und die Atmosphäre des Gesprächs.
Merkmale für destruktives Verhalten:
- Der Wille zu siegen: Das Hauptziel ist, die eigene Position durchzusetzen, manchmal um jeden Preis.
- Feindbilder schaffen: Der Gesprächspartner wird zum Gegner, dessen Argumente abgewertet werden ("Das ist doch Unsinn!").
- Nicht wirklich zuhören: Anstatt zu verstehen, worum es dem anderen geht, werden im Kopf bereits die Gegenargumente formuliert.
- Persönliche Angriffe: Das Gespräch verlässt die Sachebene und zielt darauf ab, die andere Person zu verletzen oder einzuschüchtern.
- Kurzfristiger Erfolg, langfristiger Schaden: Auch wenn man sich kurzfristig durchsetzt, leidet das Vertrauen und die Beziehungsebene nachhaltig.
Merkmale für konstruktives Verhalten:
- Der Wille zur Klärung: Das Ziel ist, das eigentliche Problem zu verstehen und gemeinsam eine gute Lösung zu finden.
- Trennung von Person und Sache: Die Sichtweise des anderen wird respektiert, auch wenn man inhaltlich anderer Meinung ist.
- Aktives Zuhören: Sie versuchen aufmerksam herauszufinden, was Ihr Gegenüber wirklich bewegt. Welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Warum ist das Thema so wichtig?
- Bewusste Deeskalation: Anstatt auf einen Angriff mit einem Gegenangriff zu reagieren, lenken Sie das Gespräch bewusst in eine ruhigere Bahn.
- Gemeinsame Lösungsfindung: Sie vertreten Ihre Position klar, sind aber gleichzeitig offen dafür, von der Perspektive des anderen zu lernen und eine Win-Win-Situation zu schaffen.
Was ist das Besondere am destruktiven Konfliktverhalten?
Bei einem Konflikt, der sich in eine destruktive Richtung entwickelt, sieht der eine den anderen Konfliktpartner als Feind und der Wunsch zu siegen überwiegt. Recht zu haben ist wichtiger, als gemeinsam ein Problem zu lösen. Die eigene Position wird dabei dominant zum Ausdruck gebracht.
Dieses Konfliktverhalten wird vom Gegenüber als kontrollierend wahrgenommen.
Dem Gesprächspartner wird nicht zugehört, sondern es geht nur darum, die eigenen Interessen resolut durchzusetzen.
Der dominante Part versucht den schwächeren zu unterdrücken, seine Schwachstellen in der Argumentation zu suchen und zu zerpflücken. Die Aussagen des Konfliktpartners werden entwertet, beispielsweise mit Aussagen, wie „so ein Schwachsinn“.
Die eigene Position wird als richtig empfunden, die des anderen als falsch. Außerdem überwiegt das Bestreben, zu überzeugen und sich durchzusetzen.
Der andere soll besiegt werden, der andere soll nachgeben und einsehen, dass er im Recht ist.
Kurzfristig erzielt man mit diesem Konfliktverhalten Erfolge, allerdings schädigt man auf lange Sicht die Beziehungsebene erheblich. Also, man kann nicht mit Vertrauen und Loyalität rechnen.
Wie findet man eine gemeinsame Lösung bei einem destruktiven Konfliktverhalten?
Vermeidendes, kontrollierendes und gefälliges Konfliktverhalten ist auf Dauer destruktiv, weil es die Beziehung schädigt.
Um eine gemeinsame Lösung zu finden, muss ein Perspektivwechsel stattfinden. Das gelingt über Einfühlen in die Situation des Anderen und benötigt Verständnis und Akzeptanz.
Konstruktives Konfliktverhalten
Jemand, dem konstruktives Konfliktverhalten wichtig ist, lässt die Angriffe des anderen unbeschadet vorbeiziehen, er geht auf die Angriffe des anderen gar nicht weiter ein.
Er widersetzt sich dem Impuls zurückzuschlagen.
Vielmehr greift er steuernd in das Geschehen ein und hört heraus, worum es seinem Gegenüber tatsächlich geht.
Anstatt siegen zu wollen, überwiegt der Wille zur Klärung. Die eigene Position wird zwar klar und deutlich vertreten, gleichzeitig ist der Wille vorhanden, die Position des anderen verstehen zu wollen.
Dazu hört der Gesprächspartner aufmerksam zu, respektiert die Sichtweise des anderen und sucht nach einer gemeinsamen Lösung.
Die 5 Konfliktstile (in Anlehnung an das Thomas-Kilmann-Modell)
Jeder von uns hat bestimmte Verhaltensmuster in Konflikten, oft ohne es bewusst zu merken. Es ist verständlich und ganz normal, in bestimmten Situationen auf gewohnte Weise zu reagieren.
Diese Muster lassen sich gut im bekannten Thomas-Kilmann-Modell wiederfinden, das fünf grundlegende Stile beschreibt:
1. Kooperierend: „Wir finden eine Lösung, die für uns beide passt.“
Nutzen: Ideal für wichtige und komplexe Themen. Beide Seiten lernen die Bedürfnisse des anderen kennen und erarbeiten eine Lösung, die von allen getragen wird. Das stärkt die Beziehung.
Grenzen: Dieser Prozess braucht Zeit und ist für schnelle oder unwichtige Entscheidungen weniger geeignet.
2. Kompromissbereit: „Ich gebe etwas nach, dafür kommst du mir entgegen.“
Nutzen: Eine schnelle und pragmatische Lösung, wenn die Ziele unvereinbar scheinen oder die Zeit drängt.
Grenzen: Oft ist keine der Parteien wirklich zufrieden, da die tieferliegenden Wünsche und Bedürfnisse nicht vollständig besprochen werden.
3. Gefällig (Nachgebend): „Lass uns es so machen, wie du möchtest.“
Nutzen: Sinnvoll, wenn Sie merken, dass Sie im Unrecht sind, oder wenn Ihnen die Harmonie in diesem Moment wichtiger ist als der Streitpunkt.
Grenzen: Auf Dauer können eigene wichtige Bedürfnisse vernachlässigt werden, was zu Unzufriedenheit führt.
4. Kontrollierend (Durchsetzend): „Es wird so gemacht, wie ich es will.“
Nutzen: Kann in Notsituationen, die sofortiges Handeln erfordern, notwendig sein.
Grenzen: Dieses Verhalten schüchtert andere ein und verhindert, dass Probleme offen angesprochen werden. Es schadet der Beziehungsebene erheblich.
5. Vermeidend: „Lass uns nicht darüber streiten.“
Nutzen: Hilfreich, wenn eine Konfrontation zu gefährlich wäre, das Thema unwichtig ist oder die Emotionen sich erst einmal beruhigen müssen.
Grenzen: Das Problem bleibt ungelöst und kann die Beziehung unterschwellig belasten, wenn es nie zur Sprache kommt.
Ein flexibles Konfliktverhalten bedeutet, je nach Situation bewusst den passendsten Stil wählen zu können. Es geht nicht darum, einen Stil zu verurteilen, sondern darum, die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern.
Bewährte Modelle zur Konfliktlösung: Ein Überblick
Um Konflikte nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern strukturiert anzugehen, haben sich verschiedene Modelle als sehr hilfreich erwiesen.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen und klaren Überblick.
| Modell/Methode | Kernprinzip | Ideal geeignet für... | Praxis-Tipp der Mediatorin |
|---|---|---|---|
| Eskalationsstufen nach Glasl | Die Dynamik eines Konflikts verstehen und erkennen, wann er eine kritische Phase erreicht. | Die Früherkennung von Krisen und die Entscheidung, ob externe Hilfe sinnvoll ist. | > Achten Sie auf den Moment, in dem es nicht mehr um die Sache, sondern um die Person geht. Das ist ein klares Warnsignal für eine Eskalation. |
| Harvard-Methode | Sachbezogen und interessenorientiert verhandeln, um eine faire Win-Win-Lösung zu finden. | Zielorientierte Verhandlungen im beruflichen Kontext, aber auch bei sachlichen Themen in der Familie. | > Die einfache Frage „Warum ist Ihnen das wichtig?“ ist der wirkungsvollste Schlüssel, um von starren Positionen zu den wahren Interessen zu gelangen. |
| Gewaltfreie Kommunikation (GfK) | Empathisch kommunizieren, indem man Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten ausdrückt. | Emotionale und beziehungsnahe Konflikte in Partnerschaft, Familie und Teams. | > Formulieren Sie eine Bitte, keine Forderung. Eine Bitte lässt Ihrem Gegenüber die Freiheit, auch ‚Nein‘ zu sagen, ohne dass die Verbindung abbricht. |
| Thomas-Kilmann-Modell | Das eigene und fremde Konfliktverhalten analysieren, um bewusst eine passende Strategie zu wählen. | Selbstreflexion, Teamentwicklung und die Erweiterung der eigenen Konfliktkompetenz. | > Es gibt keinen ‚besten‘ Stil. Erfolgreiche Konfliktlöser können je nach Situation flexibel zwischen den Stilen wechseln, um ihr Ziel zu erreichen. |
Die 9 Eskalationsstufen nach Glasl: Erkennen, wann ein Konflikt gefährlich wird
Das Modell von Friedrich Glasl ist ein wertvolles Werkzeug, um die Dynamik eines Streits besser zu verstehen.
Es zeigt, wie ein Konflikt in neun Stufen von einer einfachen Meinungsverschiedenheit zu einem Punkt eskalieren kann, an dem am Ende beide Seiten nur noch verlieren.
Die Stufen lassen sich in drei Hauptphasen einteilen:
- Phase 1 (Win-Win): Eine Lösung, bei der beide Seiten gewinnen, ist noch möglich.
- Phase 2 (Win-Lose): Es geht darum, dass eine Seite auf Kosten der anderen gewinnt.
- Phase 3 (Lose-Lose): Das Ziel ist nur noch, dem anderen zu schaden, selbst wenn man sich dabei selbst schadet.
Die Harvard-Methode: Hart in der Sache, weich zur Person
Dieses bekannte Verhandlungsmodell hilft dabei, konstruktive und faire Ergebnisse zu erzielen. Es basiert auf vier einfachen, aber wirkungsvollen Grundprinzipien:
- Mensch und Problem trennen: Kritisieren Sie die Sache, aber bleiben Sie wertschätzend gegenüber der Person.
- Auf Interessen statt Positionen fokussieren: Fragen Sie nicht „Was willst du?“, sondern „Warum ist dir das wichtig?“. So entdecken Sie die wahren Bedürfnisse hinter starren Forderungen.
- Optionen zum gegenseitigen Vorteil entwickeln: Suchen Sie kreativ nach Lösungen, die den Interessen beider Seiten gerecht werden.
- Objektive Kriterien anwenden: Einigen Sie sich auf faire Maßstäbe (z. B. externe Gutachten, rechtliche Grundlagen), um eine Lösung zu finden.
Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Rosenberg: Die Kraft der Ich-Botschaften
Die GfK ist eine wundervolle Methode für eine empathische und klare Kommunikation, besonders wenn die Emotionen hochkochen. Sie hilft, Vorwürfe zu vermeiden und stattdessen die eigenen Anliegen verständlich zu machen, indem Sie vier Schritte nutzen:
- Beobachtung: Beschreiben Sie wertfrei, was Sie wahrnehmen.
- Gefühl: Drücken Sie aus, was diese Beobachtung in Ihnen auslöst.
- Bedürfnis: Benennen Sie das unerfüllte Bedürfnis dahinter.
- Bitte: Formulieren Sie eine konkrete, erfüllbare Bitte.
Konkrete Schritte zur Konfliktlösung im Alltag: Ein Leitfaden
Theorie ist das eine, aber wie fängt man im Eifer des Gefechts an?
Verständlich, dass Sie sich in solchen Momenten überfordert fühlen.
Diese sieben praktischen Schritte können Ihnen helfen, das nächste Gespräch in eine konstruktive Richtung zu lenken:
- 1. Den richtigen Rahmen wählen: Sprechen Sie Konflikte rechtzeitig an, aber nicht zwischen Tür und Angel. Schaffen Sie einen ruhigen Moment ohne Zeitdruck.
- 2. Aktiv zuhören: Lassen Sie Ihr Gegenüber ausreden. Versuchen Sie wirklich zu verstehen, was die andere Person bewegt, anstatt schon Ihre Antwort zu planen.
- 3. Ich-Botschaften senden: Sprechen Sie von Ihren Gefühlen und Wahrnehmungen („Ich fühle mich...“, „Ich wünsche mir...“), anstatt Vorwürfe zu machen („Du machst immer...“).
- 4. In kleinen Schritten denken: Versuchen Sie nicht, alle Probleme auf einmal zu lösen. Konzentrieren Sie sich auf einen Aspekt und suchen Sie dort nach einer ersten kleinen Einigung.
- 5. Den anderen sein Gesicht wahren lassen: Drängen Sie Ihr Gegenüber nicht in eine Ecke. Bieten Sie immer eine Lösung an, bei der niemand als Verlierer dasteht.
- 6. Den Blick nach vorne richten: Verlagern Sie den Fokus von vergangenen Vorwürfen auf zukünftige Lösungen. Fragen Sie: "Was können wir tun, damit das in Zukunft für uns beide besser läuft?"
- 7. Eine Pause vereinbaren:
Wenn die Emotionen zu stark werden, ist eine kurze Auszeit hilfreich.
Sagen Sie zum Beispiel:
„Ich merke, ich bin gerade sehr aufgewühlt. Lassen Sie uns bitte in 15 Minuten weitersprechen.“
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen konstruktivem und destruktivem Konfliktverhalten?
Der wesentliche Unterschied liegt im Ziel: Beim konstruktiven Verhalten geht es um die Klärung eines Problems und eine gemeinsame Lösung, während es beim destruktiven Verhalten darum geht, Recht zu haben, zu siegen und den anderen als Feind zu besiegen.
Welche sind die wichtigsten Methoden zur Konfliktlösung?
Zu den bewährten Modellen gehören die Harvard-Methode für sachliche Verhandlungen, die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) für emotionale Konflikte und das Eskalationsmodell nach Glasl zur Analyse der Konfliktdynamik.
Wie löst man am besten Konflikte am Arbeitsplatz?
Am Arbeitsplatz ist die Harvard-Methode besonders effektiv, da sie hilft, professionell zwischen Person und Problem zu trennen. Wichtig sind zudem klare Kommunikationsregeln, das rechtzeitige Ansprechen von Problemen und bei Bedarf die Moderation durch eine neutrale Führungskraft oder eine externe Mediatorin.